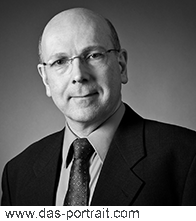Referenten
Hartmut Hotzel

Der Vorsitzende des ZKI Hartmut Hotzel leitet das IT-Servicezentrum an der Bauhaus-Universität Weimar. Er hat in den Bereichen Medizinische Forschung, Strategische IT-Entwicklung, IT-Management und in der Verwaltung an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften gearbeitet.
Aktuell ist er u.a. Mitglied im Aufsichtsrat der HIS eG sowie im Beirat der Rechenzentrumsallianz Rheinland-Pfalz. In der Kommission E-Framework, die der ZKI gemeinsam mit DINI gebildet hat, untersucht er mögliche Organisationsformen von Dienstleistungseinrichtungen für den Bereich Forschung und Lehre.
Als Vorsitzender des ZKI wurde Hartmut Hotzel im Frühjahr 2018 für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Schwerpunkte der aktuellen Amtsperiode des ZKI-Vorstands bilden u.a. die Entwicklung der Rechenzentren und die Anforderungen an die Personalentwicklung.
Hochschulrechenzentren 2025 - quo vadis | Vortragsfolien
Die Aufgaben der Hochschul-Rechenzentren (HRZ) werden sich bedingt durch den digitalen Wandel in den kommenden Jahren verändern. Eine Vielzahl neuer Aufgaben und Themenfelder werden die HRZ erreichen. Es wird zu einer zunehmenden Mitwirkung in der Gestaltung der Hochschulentwicklung und der Mit-Gestaltung von Prozessen in Lehre,
Forschung und Verwaltung kommen. Die Kompetenzen verschieben sich hin zur Orchestrierung von IT-Diensten und vielfältiger Beratung aller Hochschulangehörigen. Der
ZKI-Vorstand stellt seine Sicht in den Bereichen Personal, Governance, Software und Infrastruktur vor und diskutiert eine mögliche Vision für die IT-Versorgung der Mitgliedseinrichtungen bis in das Jahr 2025.
Günter Springer

An der Technischen Hochschule Ilmenau studierte Günter Springer Mathematik, Rechentechnik und ökonomische Kybernetik. Danach war er ab 1981 als Systemprogrammierer
für die ersten UNIX-Derivate im Organisations- und Rechenzentrum der TH Ilmenau tätig. In den Jahren der politischen Wende in der DDR 1989/1990 übernahm er zahlreiche
Aufgaben bei der Umgestaltung der TH Ilmenau zu einer wissenschaftlichen Hochschule, auch über das Rechenzentrum hinaus. Seit Ende 1995 leitet er das Universitätsrechenzentrum
der TU Ilmenau. Er war viele Jahre Mitglied des DFN-Verwaltungsrates und von 2008 bis 2010 Vorsitzender des ZKI-Vereins. Seit 2014 ist er CIO der TU Ilmenau und seit 2015 einer der beiden Gründungsvorstände des IT-Dienstleistungszentrums der Thüringer Hochschulen.
Das IT-DLZ der Thüringer Hochschulen | Vortragsfolien
Anfang 2012 erhielten die Leiter der Thüringer Hochschulrechenzentren
durch die Thüringer Landesrektorenkonferenz den Auftrag zur Restrukturierung und Neuorganisation der IT-Landschaft. Die Universitätsrechenzentren in Jena und Ilmenau sollten ein 2-Zentren-Modell umsetzen, was in die Gründung des IT-Dienstleistungszentrum der Thüringer Hochschulen mündete. Es entstand eine Governance-Struktur mit Aufsichtsrat und Vorstand sowie zahlreichen Arbeitsgruppen. Nach einer kurzen Einführung in die IT-Landschaft der Thüringer Hochschulen zeigt der Vortrag, warum Kooperation gerade unter den Bedingungen fortschreitender Digitalisierung unumgänglich ist. Dabei wird u.a. den Fragen nachgegangen: Welche Arbeitsformen haben sich besonders bewährt? Wo gibt es kleinere und auch größere Probleme? Welchen Einfluss haben die konkreten Rahmenbedingungen?
Was mit dem guten Willen Vieler gemeinsam bewirkt werden kann, zeigt u.a. das Zustandekommen dieser Tagung.
Dr. Tobias Schwabe

Dr. Tobias Schwabe ist Programmdirektor bei der DFG. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die IT-Infrastrukturförderung. Er ist studierter Diplom-Chemiker und promovierte 2010 in
Münster in Theoretischer Chemie. Nach einem Postdoktorat an der Aarhus Universität (DK) wurde er 2011 auf eine Juniorprofessur am Zentrum für Bioinformatik an die Universität Hamburg berufen. Seit 2017 geht er seinen neuen Aufgaben im Wissenschaftsmanagement nach.
Neues aus der DFG | Vortragsfolien
Die neuesten Entwicklungen bei der DFG vor allem mit Hinsicht auf die Infrastrukturförderung – insbesondere für den IT-Bereich – werden vorgestellt. Relevante Veränderungen ergaben sich einerseits durch die Bund-Ländervereinbarung aus dem November des letzten Jahres und durch die Neuformierung des Ausschusses für Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik. Im Einzelnen geht der Referent kurz ein auf den Stand zur Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), das Programm Nationales Hochleistungsrechnen
(NHR) und zu den Änderungen bei Anträgen auf Forschungsgroßgeräte ein. Außerdem werden einige Punkte aus dem DFG-Bericht „Großgeräteförderung – Entwicklung in den Jahren 2007 bis 2017“ vorgestellt.
Dr. Jurry de la Mar

Promotion in Kernphysik (Freie Universität in Amsterdam), trat 1994 in die Deutsche Telekom Gruppe ein. Nach Verantwortung für Projekte bei EU-Institutionen in Europa ist er seit 2008 Account Director für internat. Forschungs- und Raumfahrtprogramme bei T-Systems. Mit seiner aus der Kooperation mit verschiedenen Forschungsorganisationen und -projekten erworbenen Expertenkompetenzen für E-Infrastrukturen brachte er mehrere Innovationen hervor (bspw. mit der Helix-Nebula-Initiative und für das Copernicus- Programm). Er ist Mitglied im Aufsichtsrat der Cesah GmbH (seit 2009), dem Zentrum für Satellitennavigation in Hessen, und ist
erfahren in der Beratung von Geschäftsmodellen, Innovationsmanagement, Ergebnisverwertung und technischen Roadmaps.
2025: Wissenschaftliches Datenmanagement der Zukunft
Zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit brauchen Nutzer Möglichkeiten, die den FAIR-Prinzipien gerecht werden, maximalen Schutz der Daten gewährleisten, jederzeit und bei Lastspitzen verfügbar sind und sämtliche rechtliche Rahmenbedingungen erfüllen, ohne die Einrichtungen langfristig von einem Anbieter wissenschaftlichen Datenmanagements
abhängig zu machen. Basis für die Zukunftsfähigkeit sind offene Daten-Management- und Cloud-Computing-Infrastrukturen. Neben der Bereitstellung wissenschaftlicher Daten in der Cloud ist zunehmend die Auswahl spezieller Services für die Datenanalyse entscheidend, von
HPC bis KI. Es wird immer stärker auf Ressourcenverbünde gesetzt – quasi als Lösung, um eigene Rechenzentrumsfunktionen nahtlos mit neuen zu ergänzen. Der Vorteil: weitere Nutzung und bessere Planung eigener Rechen- und Speicherressourcen. Pilot-Projekte können einfach
implementiert werden, auch für komplexe Anwendungen. Diese neuen Daten-Plattformen beschleunigen und vereinfachen auch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie. Um verfügbare Satelliten-Daten besser zugänglich zu machen und effizient zu verarbeiten, setzt auch die Raumfahrtagentur ESA auf Cloud Computing. ESA hat mit Unterstützung der EU-Kommission den Copernicus Data and Information Access Service ins Leben gerufen. Dadurch soll jeder Nutzer kostenlos Zugang zu den Daten aus dem All erhalten, ohne selbst auf teure Infrastruktur zur Datenverarbeitung oder Speicherressourcen
setzen zu müssen. Dies ermöglicht die Open Telekom Cloud.
Prof. Dr. habil. Hans-Joachim Bungartz

Inhaber des Lehrstuhls für Wissenschaftliches Rechnen in der Fakultät für Informatik. Diplom-Abschlüssen in Mathematik und Informatik sowie Promotion und Habilitation in Informatik, alle an der TUM, folgten ein Mathematik-Extraordinariat in Augsburg und ein Informatik-Lehrstuhl in Stuttgart. 2005 kehrte Bungartz an die TUM zurück. Seit 2013 wirkt er sowohl als Dekan seiner Fakultät als auch als TUM Graduate Dean, mit hochschulweiter Zuständigkeit für das Promotionswesen. Er war bzw. ist Mitglied zahlreicher Editorial, Advisory oder Review Boards. 2011 wurde er Vorsitzender des Vorstands des DFN. Er ist Mitglied des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums. 2016 wurde er in das Steering Committee des Council for Doctoral Education der European University Association berufen. Seine Forschungsinteressen liegen im Spannungsbereich von Wissenschaftlichem Rechnen, CSE sowie HPC. Die meisten seiner Projekte sind fachübergreifender Natur – z.B. ist er einer der Koordinatoren des DFG-Schwerpunktprogramms SPPEXA.
DFN - technische Basis der Zukunft | Vortragsfolien
Das Wissenschaftsnetz ist die technische Infrastruktur der Wissenschaft in Deutschland. Nicht, dass dieser Umstand einer besonderen Erwähnung bedürfte, aber der Vortrag möchte ihn
dennoch etwas beleuchten – anhand aktueller Entwicklungen in der Forschung, in der Lehre, in den Kollaborationsstrukturen. Als Konsequenzen ergeben sich ein zunehmender Bedarf an zuverlässiger Bandbreite, an netznahen Diensten (eduroam, Sicherheit, föderierte Dienste, Clouds etc.), an Veranstaltungsformaten (Betriebstagung, Datenschutz, Sicherheit) und die Notwendigkeit einer engen Verflechtung mit bzw. einem Engagement in angrenzenden Bereichen von IT-Infrastruktur – Stichworte NFDI, NHR oder Verwaltungs- und Behördennetze. Schließlich braucht die technische Basis der Zukunft eine ökonomische Basis, getragen vom gemeinsamen Verständnis von Zielen und Prinzipien im DFN-Verein und gewährleistet durch ein ausgewogenes Entgeltmodell, das aktuell auf dem Prüfstand steht.
Klaus Rosifka

Seit vielen Jahren leitet der Referent im Rechenzentrum der Friedrich-Schiller-Universität Jena den Aufbau, Betrieb und die Entwicklung von IT-Service Infrastrukturen. Dort begann er im Jahr 2000 u.a. den Paradigmenwechsel vom Accountzum Identity & Access Management einzuleiten und führt diesen Transformationsprozess im Rahmen thüringenweiter Hochschulkooperationen bis heute fort.
Als Technischer Direktor des Universitätsrechenzentrums führt er die Weiterentwicklung in Themenbereichen wie Enterprise Architecture Management, IT Governance, Projekt- und Portfolio Management, IT-Service Management und Identity Access Governance an der Universität Jena und bringt seine Erfahrungen in hochschulübergreifende Kooperationen, wie dem IT-Dienstleistungszentrum der Thüringer Hochschulen ein.
IT-DLZ - IT-Architekturkonzepte hochschulübergreifend gedacht | Vortragsfolien
Methoden aus der IT-Governance, dem IT-Service Management, im Projekt Management als auch Anforderungen des täglichen IT-Betriebs stellen immer wieder Fragen zu Architekuren,
insbesondere IT-Architekturen. Für erfolgversprechende Antworten sind notwendige Strukturen, Prozesse und Expertisen im Hochschulrechenzentrum und in der Hochschule zu etablieren; und das nicht erst seit den Hypes von Digitaler Transformation oder Digitalisierung. Erfordert ein kooperatives Zusammenarbeiten im Rahmen des IT-Dienstleistungszentrums der Thüringer Hochschulen neue Sichtweisen? Stellen sich hier vielleicht ganz andere
Anforderungen an das IT-Architektur Management? Wie steht es um Reifegrade und den notwendigen Kulturwandel, wenn über Hochschulgrenzen hinaus gedacht werden muss?
Martin Wimmer

Dipl.-Phys. Martin Wimmer ist seit Oktober Leiter Informationstechnik des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE) in Bonn. Nach dem Studium der Physik mit den Schwerpunkten Wissenschaftsgeschichte, Computational Physics und Medizinphysik
an der Universität Regensburg war er für die IT eines großen medizinischen Routinelaboratoriums verantwortlich. Ab 1999 bis zum Jahr 2004 folgten mehrere Stationen in der Bayerischen Polizei. Von 2004 bis 2005 leitete er das Rechenzentrum der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Dem folgte von 2005 bis 2017 die Leitung des Rechenzentrums von Universität und Universitätsklinikum Regensburg. In der Zeit zwischen März 2006 und März 2018 gehörte der dem Vorstand des ZKI e.V. an, ab Frühjahr 2014 als dessen Vorsitzender.
Die Konkurrenz um IT-Personal - stehen die wissenschaftlichen Rechenzentren auf verlorenem Posten? | Vortragsfolien
Seit mehr als 20 Jahren ist der Mangel an qualifizierten ITFach- und Führungskräften in der öffentlichen Diskussion. Mit der „Bonner Erklärung“ hat der ZKI erstmals 2009 hierzu Stellung bezogen. Nach zehn Jahren ist eine gute Gelegenheit, auf das Erreichte und auch das Nichterreichte zurück zu blicken.
Die Tarifpartner im öffentlichen Dienst haben angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung und dem daraus resultierenden Fachkräftebedarf für die wissenschaftlichen Rechenzentren offensichtlich versagt.
Welche Möglichkeiten bestehen für die Mitgliedseinrichtungen des ZKI, ihren Fachkräftebedarf zu decken? Die Ausbildung eigener Fachkräfte (Berufsausbildung, duales Studium) ist einer der erfolgversprechenden Wege. Zudem muss der öffentliche Dienst abseits des reinen Gehalts attraktiver werden. Dies soll im Rahmen des Vortrages beleuchtet werden.
Johannes Nehlsen

Volljurist und zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter. Er beantwortet seit Mitte 2016 als Stabsstelle IT-Recht der bayerischen staatlichen Universitäten und Hochschulen für diese strategische Fragen, wenn Recht und IT zusammenkommen. Schwerpunkte bilden Datenschutzrecht, E-Government, Informationssicherheit und IT-Verträge. Die Anfragen können sich aber auch auf Bereiche wie Arbeitsrecht oder Chancengleichheit bei IT-Bezug erstrecken.
Die Beratungsstelle wurde im Rahmen des Programms „Digitaler Campus Bayern“ am Rechenzentrum der Universität Würzburg für bayerische Hochschulen etabliert. Inzwischen unterstützt Johannes Nehlsen auch die virtuelle Hochschule Bayern als Datenschutzbeauftragter. Das Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians- Universität München schloss er 2013 ab mit einem ergänzenden Zertifikatsstudiengang in Rechtsinformatik. Während seines Rechtsreferendariats am OLG München entschied er sich für eine Wahlstation bei Eversheds (nun Eversheds Sutherland) in England.
Über die Begegnung von Recht und IT im Hochschulrechenzentrum | Vortragsfolien
Vortrag gemeinsam mit Albrecht Rösler. Wer sich mit Rechtsfragen der Hochschulrechenzentren befasst, findet bereits seit längerem in der Forschungsstelle „Recht im DFN“ (Westfäl. Wilhelms-Universität / ITM, Münster) eine zuverlässige Instanz. Allerdings wächst der juristische Beratungsbedarf der Hochschulrechenzentren stetig, getrieben durch die Verrechtlichung der Dienstleistung IT und entsprechenden neuen Pflichten, z.B. bei Datenschutz und Informationssicherheit. Mit Blick auf die Dynamik und Komplexität dieser Entwicklung wurden u.a. an der Universität Würzburg (UniRZ) und in jüngerer Zeit auch am IT Dienstleistungszentrum der Thüringer Hochschulen (Standort: TU Ilmenau / UniRZ) Stabsstellen IT-Recht eingerichtet, die Aufgaben der hochschulübergreifenden Beratung wahrnehmen. Der Beitrag zeigt, warum es sich lohnt, Recht und IT in Hochschulrechenzentren näher zusammenzubringen, und stellt Voraussetzungen zur Diskussion.
Albrecht Rösler
Jurist (Ass. iur.). Nach Tätigkeit vorwiegend im Hochschulbereich und im Wissenschaftsmanagement (u.a. Fachlektor für Deutsches Recht / EU-Recht, Universität Osaka [DAAD-Juralektorat Westjapan]; Wiss. Mitarbeiter am FG Öffentl. Recht / Medienrecht, Fak. Wirtschaftswissenschaften, TU Ilmenau) Rechtsanwalt mit Ausrichtung auf IT-Recht, Medienrecht, Compliance-Kommunikation. Seit 2018: Stabsstelle für IT-Recht am IT-Dienstleistungszentrum der Thüringer Hochschulen.
Über die Begegnung von Recht und IT im Hochschulrechenzentrum | Vortragsfolien
Vortrag gemeinsam mit Johannes Nehlsen. Wer sich mit Rechtsfragen der Hochschulrechenzentren befasst, findet bereits seit längerem in der Forschungsstelle „Recht im DFN“ (Westfäl. Wilhelms-Universität / ITM, Münster) eine zuverlässige Instanz. Allerdings wächst der juristische Beratungsbedarf der Hochschulrechenzentren stetig, getrieben durch die Verrechtlichung der Dienstleistung IT und entsprechenden neuen Pflichten, z.B. bei Datenschutz und Informationssicherheit. Mit Blick auf die Dynamik und Komplexität dieser Entwicklung wurden u.a. an der Universität Würzburg (UniRZ) und in jüngerer Zeit auch am IT Dienstleistungszentrum der Thüringer Hochschulen (Standort: TU Ilmenau / UniRZ) Stabsstellen IT-Recht eingerichtet, die Aufgaben der hochschulübergreifenden Beratung wahrnehmen. Der Beitrag zeigt, warum es sich lohnt, Recht und IT in Hochschulrechenzentren näher zusammenzubringen, und stellt Voraussetzungen zur Diskussion.
Marko Hennhöfer

Marko Hennhöfer studierte an der Hochschule Mannheim Nachrichtentechnik und absolvierte aufbauend den internationalen Masterstudiengang Information Technologies. Ab 2001 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Ilmenau in verschiedenen Forschungsprojekten aktiv. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren dabei die Weiterentwicklung von Mobilfunkstandards, Algorithmen für Mehrantennensysteme, Codierungsverfahren sowie Schnittstellen zwischen Link- und Systemlevel Simulationen. Seit 2006 ist er als Lehrkraft tätig und hält neben verschiedenen Grundlagenlehrveranstaltungen auch die Vorlesung Information Theory and Coding am German Russian Institute of Advanced Technologies (GRIAT) in Kazan. Seit 2006 engagiert er sich zudem ehrenamtlich in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und seit 2013 ist er Vorsitzender des Personalrates der TU Ilmenau.
Tarifentwicklung im IT-Bereich | Vortragsfolien
Die fortschreitende Digitalisierung bei Produktions- und Verwaltungsabläufen führte während der letzten 10 Jahre zu einem verstärkten Personalbedarf im IT-Bereich. Im Werben um IT-Fachkräfte steht der öffentliche Dienst in Konkurrenz zu Unternehmen, die bei der Gestaltung von Entlohnungsund Arbeitsbedingungen i. d. R. flexibler agieren können. Stellenbesetzungsverfahren an Hochschulen gestalten sich zunehmend schwierig, da außerhalb des öffentlichen Dienstes das Lohnniveau teilweise deutlich höher liegt. Der kritischen Bewerberlage Rechnung tragend, erfolgten 2017 Verbesserungen im TVöD (Bund/Kommunen). Anhand eines Beispiels werden die Unterschiede zwischen TVöD und TV-L verdeutlicht und es erfolgt ein Vergleich zu Vergütungen in Unternehmen. Zudem werden die tarifvertraglichen Möglichkeiten zur Personalgewinnung und -bindung dargestellt. In der aktuellen Tarifrunde (TV-L) brachten die Gewerkschaften Vorschläge zur Modernisierung der Entgeltordnung ein. Über Neuigkeiten dazu wird im Rahmen des Vortrages informiert.